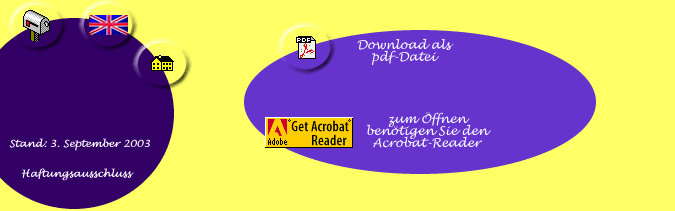ein neues Konzept der Klimapolitik
Regina Schwegler, Diplom-Volkswirtin Univ.
Diese Arbeit ist urheberrechtlich geschützt.
Sämtliche Varianten der Vervielfältigung sind,
auch auszugsweise, ohne ausdrückliche
schriftliche Genehmigung der Verfasserin unzulässig.
Inhaltsverzeichnis
Darstellungsverzeichnis
1. Internationale Klimaverhandlungen
2. Grundgedanke von Joint Implementation
3. Activities Implemented Jointly
4. Varianten der Umsetzung von Kompensationsprojekten
4.1 Bilaterale Umsetzung
4.2 Multilaterale Umsetzung
4.3 Unternehmerische Umsetzung
5. Bedenken der Entwicklungsländer
6. Probleme bei der Durchführung
6.1 Asymmetrische Information
6.2 Fehlende verbindliche Absprachen
Darstellungsverzeichnis
Darstellung 1.1: Effiziente Treibhausgasreduktionen
Tabelle 6.1: Symmetrisches Gefangenendilemma
Tabelle 6.2: Gefangenendilemma für
ein reiches Land A und ein armes Land B
Tabelle 6.3: Gefangenendilemma für
ein stark betroffenes Land A und ein weniger stark betroffenes Land
B
Tabelle 6.4: Gefangenendilemma bei Vorab-Investitionen
1. Internationale Klimaverhandlungen
Eines der größten ökologischen Probleme unserer Zeit ist die drohende Klimaveränderung durch anthropogene Treibhausgasemissionen. Wenngleich gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse bisher fehlen, so wären die Folgen einer Klimaerwärmung doch so verheerend, daß viele Staaten trotz der noch bestehenden Unsicherheit beschlossen haben, gemeinsam dieses Problem anzugehen.
Im Rahmen des Klima-Protokolls, das 1997 in Kyoto verabschiedet wurde, wurden rechtlich verbindliche Reduktionsziele für Industrieländer vereinbart. So müssen diese Länder bis in den Jahren 2008 bis 2012 die Emissionen der wichtigsten Treibhausgase durchschnittlich um 5,2 Prozent verringern. Während für die Reduktion von Kohlendioxid, Lachgas und Methan das Bezugsjahr 1990 gilt, wurde für drei weitere Gase das Jahr 1995 als Basisjahr festgelegt. Die Europäische Union hat sich das weitreichendste Ziel - eine achtprozentige Reduzierung - gesetzt. Die USA sollen sieben Prozent ihrer Treibhausgase reduzieren, Japan sechs Prozent. Da Norwegen und Island einen hohen Anteil regenerativer Energien nutzen, dürfen sie ihre Emissionen steigern, ebenso das über reiche Kohlevorkommen verfügende Australien.
Das Problem der Klimaerwärmung liegt darin begründet, daß die Erdatmosphäre eine Allmenderessource ist. Einerseits rivalisieren die Wirtschaftssubjekte um die Nutzung der Erdatmosphäre, da es sich quasi um eine erschöpfbare Ressource handelt, die sich nur sehr langsam regeneriert. Gleichzeitig können sie jedoch nicht vom Konsum derselben ausgeschlossen werden, so daß kein Markt für dieses Gut entsteht. Die Nutzer des Gutes sind daher nicht bereit, ihre Präferenzen zu offenbaren und für die Kosten der „Erstellung des Gutes" - in diesem Fall für die Erhaltung der Funktionen der Erdatmosphäre - aufzukommen. Darum werden Allmenderessourcen regelmäßig übernutzt - im diesem Fall werden zu viele Treibhausgase emittiert und Senken, die als CO2-Speicher dienen (z.B. Wälder), zerstört. Dieses Verhalten verursacht gleichzeitig externe Effekte, da auch Menschen, die die Erdatmosphäre nicht belasten, von der Zerstörung betroffen sind.
Die Probleme einer Allmenderessource weisen auf die Schwierigkeiten
hin, die sich bei den Klimaverhandlungen ergeben. Der Einsatz eines neuen
klimapolitischen Instruments, „Joint Implementation" oder „internationale
Kompensation", verspricht eine gewisse Flexibilität in der Umsetzung
der Klimapolitik. Auf der ersten Vertragsstaatenkonferenz in Berlin 1995
konnte man sich zunächst auf eine Erprobungsphase einigen, die voraussichtlich
bis 1999 andauern wird.
2. Grundgedanke von
Joint Implementation
![]()
Die Klimaerwärmung ist ein globales Problem, d.h. es ist gleichgültig,
wo Treibhausgase auf dieser Welt emittiert bzw. eingespart werden. Gleichzeitig
kann man davon ausgehen, daß die Reduktionskosten zu Beginn relativ
niedrig sind und mit zunehmender Reduktion ansteigen. Aufgrund unterschiedlicher
Entwicklungsstadien, unterschiedlicher Ressourcenausstattungen und Energiepolitiken
sind die Grenzreduktionskosten der einzelnen Staaten unterschiedlich hoch.
Man kann davon ausgehen, daß die Grenzreduktionskosten in Entwicklungsländern
aufgrund der geringeren technologischen Effizienz niedriger sind als in
Industrieländern. Der gleiche Zusammenhang gilt für die Schaffung
von Senken für Treibhausgase.
Auf der anderen Seite sind Industrieländer bisher für den
größten Teil der Treibhausgasemissionen verantwortlich und sollen
daher, gemäß dem Verursacherprinzip, die Vorreiterrolle bei
den Reduktionsanstrengungen übernehmen. Gleichzeitig befinden sich,
wie oben dargestellt, die kostengünstigsten Reduktionsmöglichkeiten
in den Entwicklungsländern. Darum ist es am effizientesten, wenn Industrieländer
in Klimaschutzprojekte in jenen Gastgeberländern investieren, in denen
die geringsten Kosten entstehen.
Dieser Zusammenhang kann an einem einfachen Beispiel veranschaulicht werden (Darstellung 1.1):
Darstellung 1.1: Effiziente Treibhausgasreduktionen
Betrachtet werden zwei Länder: das Investorland (I), das zu einer Emissionsreduktion in Höhe des Abszissenabschnitts verpflichtet ist, und das Gastgeberland (G), für das keine Reduktionsverpflichtung besteht. Die Grenzkostenkurve der Emissionsvermeidung des Gastgeberlandes (GKG) verläuft von links nach rechts, während die Grenzkostenkurve des Investorlandes (GKI) von rechts nach links verläuft. Für beide Länder wird von steigenden Grenzkosten ausgegangen. Das Investorland ist nun verpflichtet, seine Emissionen in Höhe der Strecke DB zu senken. Um die Kosten (die Fläche unter den Grenzkostenkurven) zu minimieren, ist es effizient, die Menge DC im Investorland und die Menge BC im Gastgeberland zu reduzieren. Die Reduktionskosten betragen schließlich BCF und CDF. Vergleicht man das mit den Kosten ABD, die angefallen wären, wenn die Reduktion vollständig im Investorland vorgenommen worden wäre, beträgt die Kostenersparnis ABF.
Joint Implementation kann in Anlehnung an Michaelowa nun wie folgt definiert werden:
„Ein Investor oder eine Gruppe von Investoren (ein oder mehrere Industriestaaten,
ein oder mehrere Unternehmen, ein oder mehrere Nichtregierungsorganisationen)
investieren in Maßnahmen, Projekte oder Programme im Ausland (dem
Gastgeberland), um Treibhausgasemissionen zu reduzieren oder die Bildung
und Erhaltung von CO2-Senken zu fördern. Gemäß dieses Beitrags
erhalten der oder die Investor(en) eine Gutschrift für den im Gastgeberland
erzielten Umweltvorteil in Bezug auf die Abschwächung der Klimaänderung.
Die Gutschrift muß gegen die Verpflichtung zur Emissionsreduktion
gerechnet werden, die anderenfalls der oder die Investor(en) zu tragen
gehabt hätte(n).
Unterliegen der oder die Investor(en) keiner Verpflichtung zur Emissionsreduktion
(z.B. Nichtregierungsorganisationen), muß die Kompensation anders
erfolgen (Steuervergünstigung, Subvention).
Diese Gutschrift kann auf verschiedenen Wegen erfolgen. So kann das
Unternehmen Steuervergünstigungen in Höhe der im Ausland eingesparten
Emissionen oder - im Fall eines Zertifikatensystems - kostenlos Emissionsrechte
erhalten. Sollte das Unternehmen eine ‚freiwillige Selbstverpflichtung‘
abgegeben haben, so kann es von Strafzahlungen bei Überschreitung
seiner Emissionsgrenze befreit werden. Es besteht auch die Möglichkeit,
daß der Investor vom Staat subventioniert wird." (Henrichs,
Ralf: Joint Implementation, 1997, S. 326f.)
3. Activities Implemented
Jointly
![]()
Die Mitgliedsstaaten der Klimarahmenkonvention konnten sich auf den bisherigen Klimakonferenzen auf keine endgültige Ausgestaltung des Joint Implementation einigen. Darum wird zunächst versucht, im Rahmen einer Pilotphase Erfahrungen zu sammeln. Auf der Vertragsstaatenkonferenz in Berlin wurde beschlossen, bis 1999 sogenannte „Activities Implemented Jointly" (AIJ) zuzulassen. Alle interessierten Staaten können in dieser Zeit Kompensationsprojekte durchführen. Allerdings erfolgt keine Anrechnung der Emissionsreduktionen, die im Ausland erbracht werden, auf die eigenen Reduktionsziele. Über eine konkrete Ausgestaltung von Joint Implementation soll bis zum Jahr 2000 entschieden werden.
Die Kriterien für die Pilotprojekte wurden möglichst weit gefaßt:
„Pilotprojekte für gemeinsam umgesetzte Aktivitäten müssen mit den jeweiligen nationalen umwelt- und entwicklungspolitischen Prioritäten und Strategien vereinbar sein und deren Unterstützung dienen. Alle in der Pilotphase gemeinsam umgesetzten Aktivitäten bedürfen der vorherigen Genehmigung, Zustimmung oder Bestätigung seitens der Regierungen der an diesen Aktivitäten beteiligten Vertragsparteien. Gemeinsam umgesetzte Aktivitäten müssen zu tatsächlichen, meßbaren und langfristigen Umweltvorteilen in Bezug auf die Abschwächung von Klimaänderungen führen. Die Finanzierung der gemeinsam umgesetzten Aktivitäten muß sowohl zeitlich zu den im Rahmen des Finanzmechanismus der Klimarahmenkonvention eingegangenen finanziellen Verpflichtungen der entwickelten Länder als auch zusätzlich zur derzeitigen öffentlichen Entwicklungshilfe erfolgen. Während der Pilotphase kann keine Vertragspartei durch gemeinsam umgesetzte Aktivitäten erzielte Emissionsreduzierungen auf die eigenen Verpflichtungen aus der Klimarahmenkonvention hinsichtlich der Treibhausgasemissionen angerechnet erhalten." (BMU (Hrsg.): Gemeinsam umgesetzte Aktivitäten, 1996, S. 8.)
Inländische Emittenten werden bereits in der Pilotphase bei Nachweis
einer Emissionsreduktion im Ausland von emissionsbezogenen Steuern oder
Auflagen entlastet. Der eigentliche Anreizmechanismus einer internationalen
Emissionskreditierung besteht jedoch noch nicht. Dies ist ein wesentlicher
Grund, warum die Möglichkeit der Activities Implemented Jointly-Projekte
bisher nur sehr zögerlich wahrgenommen wurde.
4. Varianten der Umsetzung
von Kompensationsprojekten
![]()
Joint Implementation-Projekte können von verschiedenen Akteuren
durchgeführt werden. Dementsprechend wird im wesentlichen zwischen
der bilateralen, multilateralen und unternehmerischen Umsetzung unterschieden.
Zusätzlich zu diesen Varianten sollen auch Nichtregierungsorganisationen
Joint Implementation-Projekte durchführen dürfen.
Bilaterale Kompensationsprojekte werden als Abkommen zwischen zwei Staaten auf Regierungsebene beschlossen. Dabei ist es möglich, einen Rahmenvertrag für alle Projekte oder für jedes Projekt jeweils einen Vertrag abzuschließen. Die Ausführung obliegt entweder privaten Unternehmen bzw. von der Regierung beauftragten Organisationen oder wird von den öffentlichen Trägern selber vorgenommen.
Die bilaterale Variante hat den Vorteil, daß sie eine hohe Flexibilität
aufweist. Gleichzeitig fehlt jedoch eine zentrale Institution, die die
Projekte überwacht, damit keine Scheinreduktionen vorgenommen werden
und Entwicklungsländer nicht Gastgeberländer von Projekten sind,
die ihnen keinen Nutzen stiften oder sogar schaden.
Im Rahmen einer multilateralen Umsetzung werden Joint Implementation-Projekte von einer internationalen Institution, einer sogenannten „Clearingstelle", konzipiert, durchgeführt und kontrolliert. Die investierenden Staaten zahlen Mittel in einen internationalen Fonds ein, um die sich Gastgeberländer bewerben können, indem sie Kompensationsprojekte anbieten. Die Clearingstelle nimmt dabei eine Vermittlungsfunktion wahr.
Kritiker dieses Ansatzes befürchten jedoch, daß eine solche internationale Institution zu groß, kostenintensiv und unflexibel werden könnte. Dabei würde die Eigeninitiative von Unternehmen gehemmt. Gleichzeitig müßten Investoren die Kosten dieser Institution tragen, so daß einige Projekte unrentabel würden. Eine internationale Organisation birgt zusätzlich die Gefahr ungleicher Machtverhältnisse zugunsten der finanziell stärkeren Investorländer.
Eine Clearingstelle, die sich auf die Durchführung und Vermittlung von Joint Implementation-Projekte spezialisiert, erzielt jedoch auf der anderen Seite Lerneffekte. Sie kann beispielsweise Musterverträge anbieten und damit die Transaktionskosten der Teilnehmer senken. Ebenso bietet es sich an, einer solchen Stelle die Vermittlung von Projektpartnern zu überlassen.
Eine zentrale Organisation kann zudem Projektportfolios bilden und den
Investoren Anteile anbieten. Dadurch sinkt aufgrund des Risikostreuung
das Risiko für die einzelnen Investoren, ähnlich wie das bei
einem Investmentfonds der Fall ist. Die Clearingstelle kann zusätzlich
die Vorstufe für eine internationale Börse sein, an der später
Emissionszertifikate gehandelt werden.
4.3 Unternehmerische
Umsetzung
![]()
Eine weitere interessante Alternative bietet die unternehmerische Umsetzung der Joint Implementation-Projekte. Unternehmen können ihre Steuer- oder Abgabenlast verringern, wenn die Kosten der Emissionsreduktion niedriger sind als die Belastung, die aufgrund der Emissionen entstanden wäre. Sogar eine freiwillige Selbstverpflichtung kann sinnvoll sein, wenn ein Unternehmen dadurch ordnungs- oder steuerpolitische Maßnahmen abwenden kann. Ebenso sichert sich ein Unternehmen eine Position auf einem Zukunftsmarkt und kann das eigene Image aufbessern. Auch im Fall der unternehmerischen Umsetzung sollte jedoch eine internationale Behörde oder ein Überwachungssystem die Emissionsreduktion überprüfen.
Der große Vorteil dieses Systems ist seine Flexibilität.
Allerdings werden nicht alle Investoren die Mittel und das Know-how haben,
Projekte selber zu konzipieren und die entsprechenden Partner zu suchen.
Darum wäre es sinnvoll, alle drei beschriebenen Varianten zuzulassen.
Sie könnten sich gegenseitig gut ergänzen und ein Engagement
für unterschiedlichste Investoren erlauben. Die Einrichtung einer
Kontrollinstitution, die auch Projekte vermitteln kann, ist in jedem Fall
notwendig.
5. Bedenken der Entwicklungsländer
![]()
Die Kompensationsprojekte sind jedoch nicht unumstritten. Vor allem Entwicklungsländer melden verschiedene Bedenken an. Sie befürchten vor allem, daß sich Industrieländer von ihren Reduktionsverpflichtungen freikaufen werden. Da Industrieländer jedoch die Joint Implementation-Projekte finanzieren und damit ihre Reduktionsverpflichtungen, freilich auf kostengünstigem Wege, erfüllen, kann von freikaufen keine Rede sein. Kostengünstige Reduktionsmöglichkeiten werden überdies die Zugeständnisse seitens der Industrieländer prinzipiell erhöhen.
Um den trotzdem vorhanden Bedenken der Entwicklungsländer zu begegnen, wurde 1997 in Kyoto eine Voraussetzung für die Durchführung von Joint Implementation-Projekten festgelegt. Danach sind Investorländer verpflichtet, einen bestimmten Prozentsatzes der Reduktionen im eigenen Land durchzuführen.
Kritiker befürchten des weiteren massive Nachteile für die Gastgeberländer. Durch Kompensationsprojekte werden die billigsten Reduktionsmöglichkeiten in diesen Ländern ausgeschöpft. Im Falle von eigenen Reduktionsverpflichtungen, die früher oder später auf sie zukommen werden, könnten sie diesen nur zu relativ hohen Kosten nachkommen. Diese Bedenken sind jedoch unbegründet. Durch Joint Implementation werden in den Gastgeberländern kostenlos Reduktionsmaßnahmen durchgeführt, so daß sich das Land ökologisch in einer besseren Ausgangslage befindet. Die bisherigen Klimaverhandlungen haben gezeigt, daß bei der Festlegung von Reduktionszielen das Verschmutzungsniveau berücksichtigt wird. So können Länder wie Norwegen und Island, die einen relativ hohen Anteil regenerativer Energien nutzen, ihre Treibhausgasemissionen sogar steigern. Entwicklungsländer, die also bereits in den Genuß von Joint Implementation-Projekten gekommen sind, werden aller Wahrscheinlichkeit nach geringere Reduktionsziele erfüllen müssen.
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Verringerung der Innovationsrate für Umwelttechnologien aufgrund geringerer Reduktionskosten. Bei dieser Sichtweise hat man jedoch das Ziel aus den Augen verloren: die Verminderung von Treibhausgasemissionen. Eine hohe Innovationsrate für Umwelttechnologien ist lediglich ein Mittel zum Zweck. Wenn es möglich ist, eine Reduktion mit geringeren Mitteln durchzuführen, ist es grundsätzlich eine Verschwendung knapper Ressourcen, wenn mehr als nötig dafür ausgegeben wird. Statt dessen liegt es nahe, daß Joint Implementation-Projekte einen weltweiten Markt für Umwelttechnologien schaffen und den technischen Fortschritt anregen werden.
Eine weitere Gefahr von Joint Implementation-Projekten wittern die Kritiker
des Konzepts darin, daß Industrieländer unausgereifte und alte
Technologien transferieren könnten. Diese Bedenken sind nur zum Teil
berechtigt. Der Transfer auch von alten Technologien kann die Situation
im Empfängerland verbessern. Zudem ist es effizient, wenn auf diese
Weise Technologien weiter genutzt werden können. Dieser positive Effekt
kommt jedoch nur zustande, wenn eine Clearingstelle den Nutzen der Projekte
für die Entwicklungsländer sicherstellt und dafür sorgt,
daß auf diese Weise nicht einfach alte Technologien entsorgt werden.
So könnte man beispielsweise Industrieländer verpflichten, eine
fachgerechte Entsorgung auch nach Nutzung in den Gastgeberländern
sicherzustellen oder sich zumindest an der Entsorgung zu beteiligen.
6. Probleme bei der Durchführung
![]()
Die Durchführung von Joint Implementation-Projekten wirft verschiedene
Probleme aufgrund asymmetrischer Information und fehlender verbindlicher
Absprachen im Rahmen der Klimaschutzverhandlungen auf.
Joint Implementation-Projekte können nur dann auf Reduktionsverpflichtungen angerechnet werden, wenn gewährleistet ist, daß durch die Projekte auch tatsächlich Treibhausgasemissionen eingespart werden. Die eingesparte Menge an Treibhausgasemissionen kann nur dann festgestellt werden, wenn bekannt ist, wie hoch in einem Referenzszenario die Emissionen ohne die Durchführung dieses Projekts gewesen wären.
Die Emissionen selbst sind relativ leicht über den Einsatz an fossilen Energieträgern abschätzbar. Die Energieeinsparungen werden ermittelt, indem der Verbrauch dieser Energieträger mit und ohne Durchführung des Projekts verglichen werden. An dieser Stelle taucht allerdings das Problem der Unsicherheit bezüglich der Referenzszenarien auf: Für das Gastgeberland besteht der Anreiz, die Reduktionsmöglichkeiten vor Durchführung des Projekts überzubewerten, um Investoren anzulocken. Nach der Durchführung ist der Investor daran interessiert, möglichst hohe Emissionsreduktionen anzugeben.
Des weiteren werden Entwicklungsländer vorgeben, kostengünstige und ineffiziente Projekte zu planen, um besonders gute Reduktionsmöglichkeiten durch Joint Implementation-Projekte anbieten zu können. Das Gastgeberland wird damit belohnt, wenn es sich nicht um Energieeffizienz kümmert.
Ebenso unbekannt sind die Investitionsabsichten der Unternehmen. Plant ein Unternehmen die Durchführung eines Projekts unabhängig von der Möglichkeit für Joint Implementation, wird es dieses Projekt selbstverständlich trotzdem als Joint Implementation-Projekt deklarieren, um die Vergünstigungen in Anspruch zu nehmen.
In den ersten beiden Fällen verliert die Umwelt, da mehr Treibhausgase emittiert werden als ohne Joint Implementation: Im ersten Fall wird ein Teil der Reduktion nur vorgetäuscht. Im zweiten Fall hätte das Entwicklungsland ohne Joint Implementation womöglich ein effizienteres Projekt geplant; der Investor hätte aber in jedem Fall die Emissionsreduktion im eigenen Land vornehmen müssen. Langfristig verlieren durch dieses Verhalten auch der Investor und das Gastgeberland durch eine Zunahme des Treibhauseffektes. Der dritte geschilderte Fall führt dazu, daß durch Joint Implementation keine zusätzlichen Treibhausgasemissionen reduziert werden.
Diese Probleme bestehen aufgrund von asymmetrischer Information. Es
fehlt ein wirksamer Anreiz für das Gastgeberland und den Investor,
ihre wahren Pläne und Reduktionen preiszugeben. Eine wirksame Kontrolle
ist nur eingeschränkt im ersten Fall möglich. Im Extremfall kann
diese Form von Marktversagen den positiven Effekt, den man sich von Joint
Implementation verspricht, ins Gegenteil umkehren.
6.2 Fehlende verbindliche
Absprachen
![]()
Bei internationalen Klimaschutzverhandlungen gibt es keine supranationale Instanz, die eine Reduktion über die Androhung von Sanktionen durchsetzen kann. Eine Übernutzung der Aufnahmekapazität der Atmosphäre kann darum nur durch freiwillige Verhandlungen verhindert werden. Freiwillige Verhandlungen werfen jedoch verschiedene Probleme auf.
Coase beschreibt im Rahmen des Coase-Theorems die Möglichkeit, wie externe Effekte durch freiwillige Verhandlungen der Akteure internalisiert werden können. Danach kommt es zu einer pareto-effizienten Lösung des Problems, wenn bestimmten Voraussetzungen erfüllt sind: Es sind nur zwei Akteure betroffen, beide verfügen über vollständige Informationen und haben bei den Verhandlungen miteinander vernachlässigbar geringe Transaktionskosten.
Im Fall der Klimaverhandlungen sind keine dieser Voraussetzungen erfüllt. Akteure sind alle Länder dieser Welt. Die Transaktionskosten von den Verhandlungen bis zum Abschluß der Verträge sind sehr hoch. Es herrscht zudem keine vollständige Information; somit ist die Überwachung der Verträge, evtl. durch eine Schiedsgerichtsbarkeit, vonnöten. Für die beteiligten Länder besteht letztendlich der Anreiz, mehr zu emittieren als sie eigentlich dürften, da Trittbrettfahrerverhalten im Fall von Treibhausgasemissionen praktisch nicht nachprüfbar und vor allem nicht sanktionierbar ist.
Das Problem des Trittbrettfahrerverhaltens läßt sich sehr anschaulich im Rahmen der Spieltheorie durch ein Gefangenen-Dilemma darstellen. In Tabelle 6.1 wird der Nettonutzen, d.h. der Nutzen aus der Reduktion abzüglich der Kosten, am Beispiel zweier Länder A und B für die Fälle dargestellt, daß die Länder ihre Treibhausgase reduzieren bzw. nicht reduzieren.
Tabelle 6.1: Symmetrisches Gefangenendilemma
Die Länder A und B haben einen relativ hohen Nutzen, wenn beide Länder Reduktionen durchführen. Gleichzeitig sind für jedes Land die Kosten für eine Reduktion sehr hoch und der Nutzen, den das Land aus der eigenen Reduktion erzielt, relativ gering. Denn im Fall der Klimaverhandlungen ist das Land nur ein einziger Akteur unter sehr vielen, so daß eine eigene Reduktion insgesamt nicht stark ins Gewicht fällt. Gleichzeitig profitieren durch die positiven externe Effekte auch alle anderen Länder von diesen Maßnahmen. Das betrachtete Land stellt sich daher dann am besten, wenn alle anderen Länder ihre Treibhausgase reduzieren und es selber zwar den Nutzen davon hat, sich aber gleichzeitig selber diese Kosten erspart.
Wenn die anderen Länder selber keine Reduktionen vornehmen, hat das Land die Möglichkeit, ebenfalls keine Reduktionen durchzuführen oder für die Reduktion hohe Kosten aufzuwenden, selber aber nur einen relativ geringen Nutzen daraus zu ziehen. Es ist daher auch in diesem Fall individuell rational, wenn das Land seine Treibhausgasemissionen nicht reduziert.
Sofern es nicht möglich ist, verbindliche Absprachen zu treffen, ist die dominante Strategie und damit das Nash-Gleichgewicht dieser Situation, nicht zu kooperieren. Da dieses Ergebnis pareto-inferior gegenüber einer Kooperation beider Länder ist, besteht ein soziales Dilemma, d.h. die individuelle Rationalität entspricht hier nicht der gesellschaftlichen Rationalität.
Wird das Verhalten beider Länder im Rahmen eines asymmetrischen Spiels untersucht, ist das Ergebnis das gleiche. Es könnte sich z.B. um ein wohlhabendes Land (Industrieland) und ein weniger wohlhabendes Land (Entwicklungsland) handeln, oder um zwei Länder, die durch die Klimaveränderung unterschiedlich hart betroffen sind.
Für ein armes Land B (Entwicklungsland) fallen die Reduktionskosten stärker ins Gewicht als für ein reiches Land A (Industrieland). Darum ist der Nettonutzen für die eigene Reduktion geringer als für das Industrieland
Tabelle 6.2: Gefangenendilemma für ein reiches Land A und ein armes Land B
Für den dritten Fall, daß Land A von den Klimaveränderungen stärker betroffen ist als Land B, sind der Schaden für das Land A, wenn die Treibhausgase nicht reduziert werden, relativ hoch (Tabelle 6.3).
Tabelle 6.3: Gefangenendilemma für ein stark betroffenes Land A und ein weniger stark betroffenes Land B
Auch in diesen Fällen gilt das obige Ergebnis: Für beide Länder ist es nicht optimal zu kooperieren, so daß auch hier ein pareto-inferiores Ergebnis zustande kommt. Dieses Problem kann nur durch verbindliche Absprachen gelöst werden.
Die internationalen Verhandlungen über die Klimaerwärmung weisen einige Unterschiede zu den obigen Darstellungen auf:
1. Das Spiel wird wiederholt gespielt. Hierbei können die beiden Varianten betrachtet werden:
- Die Anzahl der Wiederholung der Spiele ist endlich.
- Das Spiel wird unendlich oft wiederholt.
3. Die Spieler können bereits vor Beginn des Spieles handeln
und den Hergang des Spieles beeinflussen.
Tit for tat
Wenn ein Spiel mehrfach gespielt wird, gibt es die Möglichkeit des „tit for tat"; d.h. es wird zu Beginn des Spieles gedroht, daß man nur solange kooperieren werde, wie die andere Partei kooperiert.
Bei einer endlichen Wiederholung des Spieles ist das Ergebnis das gleiche wie oben beschrieben. Die Teilnehmer wissen, daß bei dem letzten Spiel nicht kooperiert wird, da die Drohung dann nicht mehr wirksam sein wird. Daraufhin werden sie aber auch beim vorletzten Spiel nicht kooperieren, da auch dort die Drohung hinfällig ist. Auf diese Weise wird eine Rückwärtsinduktion in Gang gesetzt die dafür sorgt, daß bei keinem Spiel kooperiert wird.
Wird ein Spiel unendlich oft wiederholt, liegt also ein sogenanntes „Superspiel" vor, funktioniert die Drohung des „tit for tat", so daß die Vertragsländer kooperieren werden. Bei den Klimaverhandlungen kann davon ausgegangen werden, daß kein Ende abzusehen ist, so daß der unendliche Zeithorizont gerechtfertigt ist. Trotzdem ist dieses Ergebnis nur für eine Variante mit zwei Spielern gültig.
Bei den Klimaverhandlungen sind jedoch mehr als zwei Spieler beteiligt. In diesem Fall bewirkt der Anreiz des Trittbrettfahrens, daß unvollständige Verträge stattfinden, bei denen manche Staaten Trittbrett fahren und manche Staaten kooperieren. Dies liegt daran, daß der Drohmechanismus des „tit for tat" nicht mehr funktioniert. Selbst wenn ein Staat nicht kooperiert, ist es für die anderen Staaten (vorausgesetzt, sie repräsentieren einen Großteil der Emittenten) weiterhin lohnend, zu kooperieren, da der Schaden wesentlich größer wäre, wenn alle Staaten aussteigen würden. Es kann sogar für die verbleibenden Staaten sinnvoll sein, die eigenen Reduktionen zu steigern. Denn wenn ein Land seine Reduktionen senkt, steigt der Grenznutzen einer zusätzlichen Reduktion für die verbleibenden Staaten.
Dieses Ergebnis ist trotzdem suboptimal. Die Frage ist nun, ob es möglich
ist, Mechanismen zu finden, die eine Kooperation aller Staaten bewirken
können.
Strategisches Verhalten
Ein solcher Mechanismus könnte darin bestehen, daß nicht-kooperierende Staaten ihrem Ruf schaden könnten. Dies wird jedoch i.a. nicht ausreichen. Wirksamere Maßnahmen wie Wirtschaftssanktionen sind in der Klimarahmenkonvention nicht vorgesehen, und das Anrufen eines internationalen Gerichtshofes läuft auf ein langwieriges Verfahren hinaus. Darum gilt es, einen Mechanismus zu finden, der die Durchsetzbarkeit des Abkommens garantieren kann. Dann wären Staaten, die bereits unterzeichnet haben, zur Kooperation gezwungen, und es würden zusätzliche Staaten unterzeichnen, da der Vertrag nun Aussicht auf Erfolg hätte.
Eine Möglichkeit, die Trittbrettfahrer-Verhalten verhindern könnte, wäre „strategisches Verhalten": Vertragsstaaten könnten die Erfüllung bestimmter Verpflichtungen als notwendige Voraussetzung für die Teilnahme an Joint Implementation-Projekten festschreiben. Die teilnehmenden Staaten müßten diese nachprüfbaren Voraussetzungen bereits vor Inkrafttreten des Abkommens erfüllen. Solche Verpflichtungen könnten beispielsweise Vorab-Investitionen in Reduktionstechnologien (Ex-ante-Investitionen) sein (siehe Tabelle 6.4).
Tabelle 6.4: Gefangenendilemma bei Vorab-Investitionen
Unter der Voraussetzung, daß die Vorab-Investitionen eine kritische Höhe überschreiten, ist das Trittbrettfahren nicht mehr attraktiv, da bei Nicht-Kooperation die vorab getätigten Reduktionsinvestitionen verloren sind. Das neue Nash-Gleichgewicht ist in diesem Fall die Kooperation aller Staaten. Dieses Ergebnis ist zugleich gesellschaftlich optimal.
Ein weiterer positiver Effekt dieses strategischen Verhaltens wäre, daß die Glaubwürdigkeit des Abkommens gestärkt würde. Daraufhin würden mehr Staaten dem Vertrag beitreten. Insbesondere für die Teilnahme von Entwicklungsländern wäre dies sehr wichtig, da diese auf eine Vorreiterrolle der Industrieländer bestehen. Entwicklungsländer haben historisch gesehen weder in größerem Umfang zur Entstehung des Treibhauseffektes beigetragen, noch haben sie die finanziellen Mittel, um Emissionreduktionen zu betreiben.
Leider sind Ex-ante Investitionen explizit nicht in der Klimakonvention
vorgesehen. Unter Umständen müssen jedoch Vertragspartner bestimmte
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen bezüglich finanzieller
Mittel und der Weitergabe von Technologien an Entwicklungsländer erfüllen,
bevor sie an dem System der Joint Implementation teilnehmen dürfen.
Durch Joint Implementation ergibt sich eine „win-win-win"-Situation für den Investor, das Gastgeberland und die Umwelt. Der Investor kann in kostengünstigere Reduktionsmöglichkeiten investieren, so daß die Anpassungskosten bei der Einführung von Emissionssteuern oder Zertifikaten gesenkt werden. In das Gastgeberland kommt in den Genuß kostenloser Technologien. Dort können Kompensationsprojekte, wenn sie erfolgreich durchgeführt werden, das Bewußtsein für das Klimaproblem schärfen und eigene Anstrengungen verstärken. Des weiteren verhindern sie Fehlinvestitionen in energie- und emissionsintensive Technologien, die bei dem früher oder später notwendigen Übergang zu einer klimaverträglichen Ökonomie vorzeitig entwertet würden. Der Umwelt kommen die eingesparten Treibhausgasemissionen direkt zugute.
Allerdings gibt es einige Probleme, mit deren Lösung der Erfolg des Joint Implementation-Konzeptes steht oder fällt. Vertraglichen Reduktionsverpflichtungen werden nur eingehalten, wenn internationale Sanktionsmechanismen etabliert oder Vorab-Investitionen vorgeschrieben werden. Das Problem unvollständiger Informationen könnte zumindest teilweise durch eine Kontrollinstanz gelöst werden.
Joint Implementation ist damit ein erfolgsversprechendes Konzept. Doch
auch hier steckt, die so oft, der Teufel im Detail.
Banholzer, Kai: Joint Implementation - Ein Instrument der globalen Klimapolitik, in: Simonis, Udo E. (Hrsg.): Weltumweltpolitik - Grundriß und Bausteine eines neuen Politikfeldes, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin: Rainer Bohr Verlag, 1996, S. 87-101
Banholzer, Kai: Joint Implementation: Ein nützliches Instrument des Klimaschutzes in Entwicklungsländern?, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin, 1996
BMU (Hrsg.): Gemeinsam umgesetzte Aktivitäten zur globalen Klimavorsorge - „Activities Implemented Jointly" (AIJ), Bonn: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 1996
Feser, Hans-Dieter/von Hauff, Michael (Hrsg.): Neuere Entwicklungen in der Umweltökonomie und -politik, Regensburg: Transfer Verlag, 1997 (Volkswirtschaftliche Schriften Universität Kaiserslautern, Band 6)
Henning, Rentz: „Joint Implementation" in der internationalen Umweltpolitik - Eine theoretische Analyse möglicher Ausgestaltungen, in: Zeitschrift für Umweltpolitik & Umweltrecht, Heft 2, 1995, S. 179-203
Henrichs, Ralf: Joint Implementation als neues Konzept der Umweltpolitik, in: Feser, Hans-Dieter/von Hauff, Michael (Hrsg.): Neuere Entwicklungen in der Umweltökonomie und -politik, Regensburg: Transfer Verlag, 1997, S. 323-343 (Volkswirtschaftliche Schriften Universität Kaiserslautern, Band 6)
Jepma/Catrinus J. (Hrsg.): The Feasibility of Joint Implementation, Dordrecht: Kluwer Acadamic Publishers, 1995
Jöckel, Andreas: Klima-Kompromiß - Fünf Prozent weniger Treibhausgase - Echo geteilt, in: Rhein-Zeitung, 11.12.1997
Michaelowa, Axel/Dutschke, Michael: Interest groups and efficient design of the Clean Development Mechanism under the Kyoto Protocol, HWWA Discussion Paper No. 58, Hamburg, März 1998
Neue Zürcher Zeitung (Hrsg.): Internationale Kompensation von Treibhausgasemissionen - Emissionsverringerung weltweit ermöglicht Klimaschutz zu geringeren Kosten, 20.06.1995
Pearce, David: Joint Implementation - A general overview, in: Jepma/Catrinus J. (Hrsg.): The Feasibility of Joint Implementation, Dordrecht: Kluwer Acadamic Publishers, 1995, S. 15-31
Simonis, Udo E. (Hrsg.): Steuern, Joint Implementation, Zertifikate - Zum Instrumentarium der Weltumweltpolitik, in: Simonis, Udo E. (Hrsg.): Weltumweltpolitik - Grundriß und Bausteine eines neuen Politikfeldes, Wissenschaftszetrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin: Rainer Bohr Verlag, 1996, S. 102-118
Simonis, Udo E. (Hrsg.): Weltumweltpolitik - Grundriß und Bausteine eines neuen Politikfeldes, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin: Rainer Bohr Verlag, 1996